Bildungspolitik
2022-2027
"Schule sollte ein guter Ort des Lernens und Zusammenlebens sein. Deshalb muss uns gute Schule künftig mehr wert sein, als das heute der Fall ist. Alle Verantwortlichen in Ländern und Kommunen sollten jetzt gemeinsam handeln!"
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlin 14.06.2018
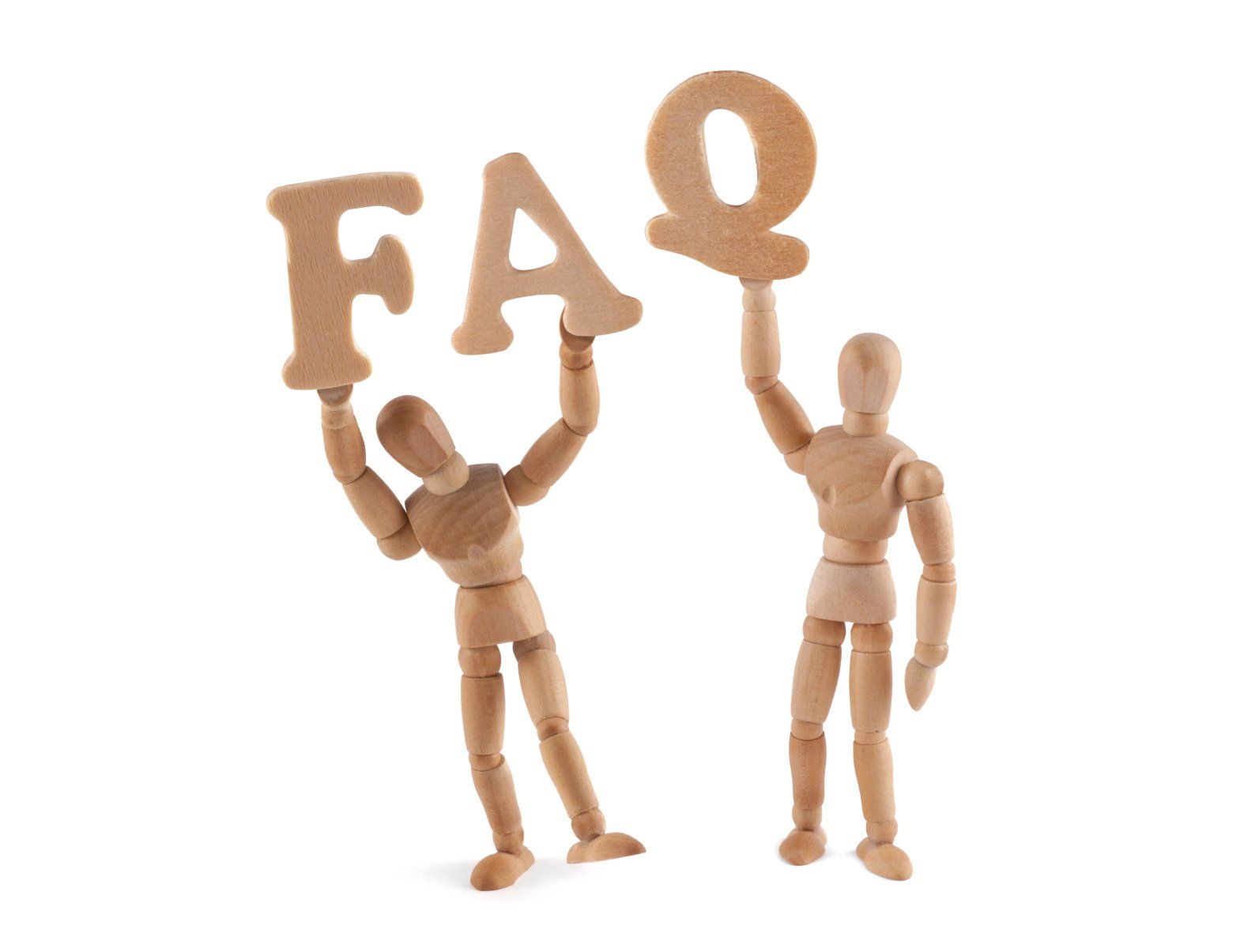
Fragen und Antworten zur Bildungspolitik 2022-2027 vor der Landtagswahl 2022
"Initiative ergreifen, Probleme öffentlich machen, Bildungspolitik kritisch begleiten", das ist unser Motto. Wir, die Landeselterninitiative für Bildung, setzen uns seit Jahren ein für gelingende Schulen.
Deshalb haben wir Fragen zur Bildungspolitik 2022-2027 im Saarland vor der Landtagswahl 2022 an die Landesvorsitzenden von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und bunt.saar gestellt. Dabei haben wir uns auf neun ganz spezielle Fragen beschränkt und um sehr konkrete, kurze Antworten gebeten. Die Fragen und Antworten geben wir hier unverändert, wörtlich wieder.
Serviceliste
-
BildungsausgabenListenelement 1
Das Saarland (Land, Kreise, Kommunen) stellt an öffentlichen Bildungsausgaben am wenigsten von allen Bundesländern bereit (1 527 € je Einwohner, Bundesdurchschnitt 1 977 €). Der Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben am Landeshaushalt 2021 ist mit 28,5 % der niedrigste aller Flächenländer (Durchschnitt westliche Flächenländer 40,1 %, östliche Flächenländer 37,9 %).
Wo sollte nach Ihrer Ansicht das Saarland im Jahr 2027 bei diesen beiden Kennzahlen stehen? Was wollen Sie konkret dafür tun?
-
PersonalisierungListenelement 2
Die sehr unterschiedlichen Ausgangslagen und pädagogischen Herausforderungen für Schulen müssen systematisch und nachvollziehbar berücksichtigt werden; d.h. ihr individueller Bedarf an Professionen muss systematisch sowie verlässlich festgestellt werden. Anhand landesweit einheitlicher, messbarer Kriterien wie z. B. schulgenauer Daten zu den sozialen Lebensumständen der Kinder und Jugendlichen.
Wie stehen Sie zu dieser Forderung? Was wollen Sie in den nächsten fünf Jahren tun, um die Personalisierung von Schulen (in herausfordernden Lagen) zu verbessern?
-
SchulentwicklungListenelement 3
Schulen in herausfordernden Lagen brauchen aber nicht nur eine bessere Personalausstattung, sondern auch Unterstützung im Umgang mit ihren jeweiligen schulspezifischen Bedingungen, um so den Bildungserfolg ihrer Schülerinnen und Schüler zu erhöhen. Dazu ist eine externe Begleitung ihres Prozesses der Schul- und Unterrichtsentwicklung, aber auch der Personalentwicklung durch Beraterinnen und Berater mit hoher praktischer Erfahrung notwendig. Ebenso ein regelmäßiges Angebot an Supervision.
Wie stehen Sie dazu? Was wollen Sie konkret insoweit tun?
-
BildungsarmutListenelement 4
Von Armut bedrohte Kinder und Jugendliche, im Saarland sind dies rund 21 Prozent, verfügen längst nicht über dieselben Bildungschancen wie Gleichaltrige aus finanziell gesicherten Familien. Bildung aber ist ein wesentlicher Schlüssel, um aus dem generationenübergreifenden Teufelskreis der Armut auszubrechen. Schulen mit vielen Kindern aus prekären Lebensverhältnissen brauchen gesellschaftliche Unterstützungssysteme mit begleitenden kulturellen Anregungen sowie Bildungsangeboten im Sozialraum. Dazu bedarf es einer gemeinschaftlichen Anstrengung und staatlicher Steuerung der ergänzenden Angebote im Schulumfeld.
Wie stehen Sie dazu? Was wollen Sie konkret insoweit tun?
-
Echte Ganztagsschulen
Es ist notwendig, das Angebot an echten Ganztagsschulen flächendeckend auszubauen. Denn Ganztagsschulen bieten mehr Zeit und Raum für den Ausgleich individueller Leistungsunterschiede sowie eines schlechten außerschulischen Lernumfeldes bzw. mangelnder Bildungsunterstützung seitens der Eltern.
Wie stehen Sie dazu? Was wollen Sie konkret insoweit tun?
-
Ethik
Allen Schülerinnen und Schülern des Saarlandes soll künftig immer ein Angebot der Werteerziehung gemacht werden – auch jenen, die am bestehenden Religionsunterricht nicht teilnehmen möchten oder sollen. Wir fordern daher die Einführung des Fachs Ethik an der Grundschule, die Ausbildung von Fachlehrern hierfür und die flächendeckende Versorgung an weiterführenden Schulen.
Was meinen Sie dazu? Was wollen Sie in dieser Hinsicht tun?
-
Schulsozialarbeit
Die Novelle des Schulmitbestimmungsgesetzes (SchumG) im Jahr 2021 sehen wir als Meilenstein für mehr gelebte Demokratie an Schulen an. Sie führte jedoch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulsozialarbeit keine Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte in den verschiedenen Gremien der schulischen Zusammenarbeit ein, anders als für Förderlehrkräfte. Und dies, obwohl die Schulsozialarbeit mit der allgemein anerkannten, landesweiten Neuaufstellung im Jahr 2020 Regelleistung und Aufgabe der Schule geworden ist und die Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter gerade in der Pandemie wertvollste Arbeit leisten.
Was wollen Sie konkret tun, um dies zu ändern?
-
Demokratiepädagogik
Wir begrüßen ausdrücklich die Einführung des Klassenrats mit der Novelle des SchumG (fakultativ ab Klassenstufe 1, verbindlich ab Klassenstufe 3) zur Förderung des demokratischen Miteinanders und der Partizipation in der Schule (§ 20) sowie die Beschreibung seines Zwecks sowie seiner Themen im Gesetz.
Wie stehen Sie zu unserer in den Anhörungen bis zum Landtag vorgetragenen Forderung, dass folglich der Klassenrat als fester Bestandteil in den wöchentlichen Stundentafeln aller Jahrgänge und Schulformen auch verankert wird?
-
Hauptschulabschluss
Wir plädieren dafür, den erfolgreichen Abschluss der Klasse 9 an Gemeinschaftsschulen als Hauptschulabschluss anzuerkennen. Hauptschulabschlussprüfungen sind, anders als die Abiturprüfungen, von der KMK nicht vorgeschrieben und werden in vielen Bundesländern nicht durchgeführt. Stattdessen könnten die Abschlussnoten in den einzelnen Fächern aus den Klausurergebnissen und Unterrichtsergebnissen des letzten Schuljahres gebildet werden. Nach KMK-Vereinbarung wird der Hauptschulabschluss erteilt, wenn in allen Fächern ausreichende Leistungen vorliegen oder schlechtere Leistungen ausgeglichen werden.
Die Organisation der zusätzlichen Abschlussprüfungen kostet alle Beteiligten sehr viel Zeit. Jeder Schüler muss drei Abschlussklausuren und mündliche Prüfungen absolvieren. Diese Zeit sollte besser genutzt werden, um mehr Unterricht zu erteilen, mehr zu lernen und Versäumtes nachzuholen.
Wie stehen Sie dazu?


